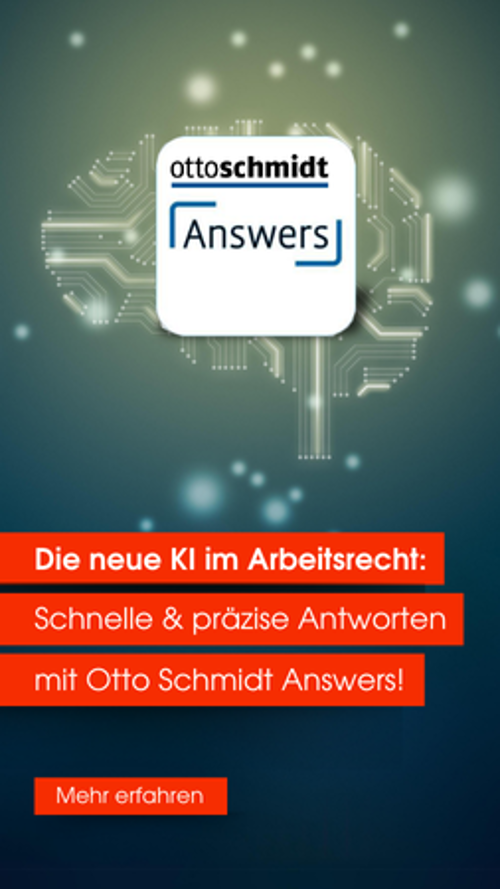E-Book, Deutsch, Band 50, 392 Seiten
Reihe: Schriften zum Europäischen und Internationalen Privat-, Bank- und Wirtschaftsrecht
Watzenberg Der homo oeconomicus und seine Vorurteile
1. Auflage 2014
ISBN: 978-3-11-034279-6
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
Eine Analyse des zivilrechtlichen Benachteiligungsverbots
E-Book, Deutsch, Band 50, 392 Seiten
Reihe: Schriften zum Europäischen und Internationalen Privat-, Bank- und Wirtschaftsrecht
ISBN: 978-3-11-034279-6
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
- Untersuchung des zivilrechtlichen Benachteiligungsverbotes
- interdisziplinäre Arbeit zum Thema Diskriminierung und Recht
- Analyse anhand ökonomischer und psychologischer Theorien
- originäre Herangehensweise an ein komplexes rechtliches Problem
Diese Arbeit untersucht in positiver Hinsicht diskriminierende Entscheidungen und geht der Frage nach, ob und wie das Vertragsrecht in diese Entscheidungen eingreifen kann. Ob ein zivilrechtliches
Benachteiligungsverbot auch normativ geboten und sinnvoll ist, wird im letzten Teil der Arbeit erörtert.
Der Untersuchungsgegenstand ist hierbei der zivilrechtliche Regelungsbereich des AGG und die zugrunde liegenden individuellen Entscheidungen. Er wird aus rechtswissenschaftlicher, ökonomischer und
psychologischer Perspektive betrachtet.
Zielgruppe
Wissenschaftler, Institute, Bibliotheken
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
1;Einleitung: Das agg als Prüfstein der Interdisziplinarität;15
2;1. Teil: Die Methode;27
2.1;A Neoklassik und Institutionenökonomik;29
2.1.1;1 Die Neoklassik;31
2.1.1.1;1.1 Die Ressourcenknappheit und der Markt;32
2.1.1.2;1.2 Das Spektrum der Rationalität;33
2.1.1.2.1;1.2.1 Das definitorische Konzept;34
2.1.1.2.2;1.2.2 Die Theorie des Subjektiven Erwartungsnutzens;35
2.1.1.2.3;1.2.3 Die Version des Eigeninteresses;38
2.1.1.2.4;1.2.4 Konzept der Wohlstandsmaximierung;39
2.1.1.2.5;1.2.5 Stellungnahme: Die Möglichkeit der Falsifikation;40
2.1.1.3;1.3 Nutzenmaximierung und die Stabilität der Präferenzordnung;42
2.1.1.4;1.4 Unterscheidung von Restriktionen und Präferenzen;45
2.1.1.5;1.5 Der Begriff der Effizienz als elementarer Bestandteil der Wohlfahrtsökonomik;46
2.1.2;2 Institutionenökonomische Analyse;48
2.1.2.1;2.1 Institutionen;48
2.1.2.2;2.2 Eingeschränkte Rationalität und Transaktionskosten;52
2.1.2.2.1;2.2.1 Eingeschränkte Rationalität;52
2.1.2.2.2;2.2.2 Positive Transaktionskosten und effiziente Rechtsregeln;55
2.1.3;3 Das Coase-Theorem;62
2.1.4;4 Die ökonomische Analyse des Vertragsrechts;66
2.1.4.1;4.1 Vertrag und Vertragsfreiheit;66
2.1.4.2;4.2 Externe und pekuniäre Effekte;69
2.1.4.3;4.3 Vertragsrisiko und Opportunismus;70
2.1.4.4;4.4 Funktion des Vertragsrechts in der ökonomischen Analyse des Rechts;71
2.1.4.4.1;4.4.1 Grundsätzliche Funktion des Rechts;71
2.1.4.4.2;4.4.2 Funktion des Vertragsrechts;72
2.1.4.5;4.5 Formale Vertragstheorien;73
2.1.4.5.1;4.5.1 Die Prinzipal-Agent-Theorie;74
2.1.4.5.2;4.5.2 Die Theorie der sich selbst durchsetzenden Vereinbarungen;76
2.1.4.5.3;4.5.3 Die Theorie unvollständiger Verträge;77
2.1.5;5 Methodischer Status des homo oeconomicus und Ausblick;78
2.2;B Verhaltensökonomie und kognitive Psychologie;79
2.2.1;1 Heuristics and Biases;81
2.2.1.1;1.1 Verfügbarkeit;82
2.2.1.2;1.2 Repräsentativität;83
2.2.1.3;1.3 Affekt-Heuristik;85
2.2.1.4;1.4 Anchoring and Adjustment;87
2.2.1.5;1.5 Hindsight Bias;89
2.2.1.6;1.6 Status Quo Bias und Self-Serving Bias;89
2.2.1.7;1.7 Der Besitz-Effekt und das Coase-Theorem;90
2.2.1.8;1.8 Kritische Würdigung;92
2.2.2;2 Zwei-Prozesse Theorie;96
2.2.2.1;2.1 Die Ausdifferenzierung der Entscheidungssysteme;96
2.2.2.2;2.2 Facetten von Rationalität;100
2.2.3;3 Die unbewussten Vorurteile (Implicit Bias);104
2.2.3.1;3.1 Die Erfassung der unbewussten Vorurteile und ihre Relevanz;104
2.2.3.1.1;3.1.1 Stereotype und Vorurteile;104
2.2.3.1.2;3.1.2 Stereotype und Vorurteile in Deutschland;108
2.2.3.1.2.1;3.1.2.1 Geschlecht;108
2.2.3.1.2.2;3.1.2.2 »Rasse« und ethnische Herkunft;109
2.2.3.1.2.3;3.1.2.3 Religion;110
2.2.3.1.2.4;3.1.2.4 Behinderung;111
2.2.3.1.2.5;3.1.2.5 Alter;112
2.2.3.1.2.6;3.1.2.6 Sexuelle Identität;113
2.2.3.1.3;3.1.3 Der Implizite Assoziationstest;113
2.2.3.2;3.2 Stereotype, Vorurteile und Verhaltensökonomie;118
2.2.4;4 Exkurs: Gesellschaftliche Strukturen und ihre Rechtfertigung;120
2.3;C Zusammenfassung;127
3;2. Teil: Der Untersuchungsgegenstand;135
3.1;A Ziel und Zweck der zivilrechtlichen Regelungen des agg;137
3.2;B Europarechtliche Vorgaben und richtlinienkonforme Auslegung;138
3.2.1;1 Europarechtliche Vorgaben;138
3.2.1.1;1.1 Die Antirassismusrichtlinie;138
3.2.1.2;1.2 Die Gender-Richtlinie;141
3.2.1.3;1.3 Neuere Entwicklung;142
3.2.2;2 Der Grundsatz der richtlinienkonformen Auslegung;143
3.2.2.1;2.1 Grundsatz;143
3.2.2.2;2.2 Überschießende Umsetzung;144
3.3;C Geschützte Merkmale;146
3.3.1;1 »Rasse«;148
3.3.2;2 Ethnische Herkunft;150
3.3.3;3 Geschlecht;153
3.3.4;4 Sexuelle Identität;154
3.3.5;5 Religion und Weltanschauung;156
3.3.6;6 Behinderung;159
3.3.7;7 Alter;161
3.4;D Sachlicher Anwendungsbereich;163
3.4.1;1 Formen der Benachteiligungen;163
3.4.1.1;1.1 Die unmittelbare Diskriminierung;164
3.4.1.2;1.2 Die mittelbare Diskriminierung;168
3.4.1.3;1.3 Die Belästigung und die sexuelle Belästigung;170
3.4.1.4;1.4 Die Anweisung zur Diskriminierung;173
3.4.2;2 Erfasste Schuldverhältnisse;173
3.4.2.1;2.1 Massengeschäft und »Beinahe-Massengeschäft«;174
3.4.2.2;2.2 Privatrechtliche Versicherungen;176
3.4.2.3;2.3 Schutzbereichserweiterung Merkmale »Rasse« und ethnische Herkunft;180
3.4.3;3 Die Regelungen des § 19 Abs. 3 bis 5;182
3.4.3.1;3.1 Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen;183
3.4.3.2;3.2 Familien- und erbrechtliche Schuldverhältnisse;184
3.4.3.3;3.3 Besondere Nähe- oder Vertrauensverhältnisse;184
3.5;E Rechtfertigungen;187
3.5.1;1 Der sachliche Grund;187
3.5.2;2 Rechtfertigung bei Versicherungsdiskriminierung;191
3.5.3;3 Positive Maßnahmen;195
3.6;F Die Ansprüche;196
3.6.1;1 Der Beseitigungsanspruch;196
3.6.2;2 Der Unterlassungsanspruch;201
3.6.3;3 Anspruch auf Ersatz des materiellen Schadens;202
3.6.3.1;3.1 Anspruch auf Ersatz des materiellen Schadens;202
3.6.3.2;3.2 Anspruch auf Ersatz des immateriellen Schadens;205
3.6.4;4 Die Frist;206
3.7;G Die Beweislast;208
3.8;H Die Antidiskriminierungsverbände;215
3.9;I Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes;218
3.10;J Die Unabdingbarkeit der Regelungen;222
3.11;K Das Verhältnis von agg zu sonstigen Regelungen;223
3.12;L Zusammenfassung;224
4;3. Teil: Die Anwendung;233
4.1;A Diskrminierungen und ihre theoretische Einordnung;235
4.1.1;1 Diskriminierende Entscheidungen in der ökonomischen Analyse;235
4.1.1.1;1.1 Stereotype und Vorurteile als kostengünstige Informationen;235
4.1.1.2;1.2 Interdependente Nutzenordnungen von Männern und Frauen;236
4.1.1.3;1.3 Frauen und Humankapital;238
4.1.1.4;1.4 Diskriminierungen und ökonomische Prämissen;239
4.1.2;2 Die diskriminierende Entscheidung jenseits des homo oeconomicus;245
4.1.2.1;2.1 Heuristiken und Entscheidungssysteme;245
4.1.2.2;2.2 Das Unbewusste und die diskriminierende Entscheidung;247
4.2;B Exkurs: Gesetz versus sozialer Druck;249
4.3;C Die Analyse;253
4.3.1;1 Erfasste Formen von Benachteiligungen;253
4.3.1.1;1.1 Die unmittelbare Diskriminierung;253
4.3.1.1.1;1.1.1 Aus neoklassischer Sicht;253
4.3.1.1.2;1.1.2 Aus institutionenökonomischer Sicht;254
4.3.1.1.3;1.1.3 Psychologische Aspekte;255
4.3.1.2;1.2 Die mittelbare Diskriminierung;257
4.3.1.2.1;1.2.1 Aus neoklassischer Sicht;257
4.3.1.2.2;1.2.2 Aus institutionenökonomischer Sicht;258
4.3.1.2.3;1.2.3 Psychologische Aspekte;258
4.3.1.3;1.3 Die Belästigung und die sexuelle Belästigung;259
4.3.1.3.1;1.3.1 Aus neoklassischer Sicht;259
4.3.1.3.2;1.3.2 Aus institutionenökonomischer Sicht;260
4.3.1.3.3;1.3.3 Psychologische Aspekte;260
4.3.1.4;1.4 Die Anweisung zur Diskriminierung;262
4.3.2;2 Erfasste Schuldverhältnisse und Bereichsausnahmen;262
4.3.2.1;2.1 Aus neoklassischer Sicht;263
4.3.2.2;2.2 Aus institutionenökonomischer Sicht;264
4.3.2.3;2.3 Psychologische Aspekte;264
4.3.3;3 Die Ansprüche;265
4.3.3.1;3.1 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch, § 21 Abs. 1 S. 1;267
4.3.3.1.1;3.1.1. Aus neoklassischer Sicht;267
4.3.3.1.1.1;3.1.1.1 Auswirkungen bei (Quasi-)Massenverträgen;267
4.3.3.1.1.2;3.1.1.2 Auswirkungen bei einem einzelnen Vertragsschluss;271
4.3.3.1.1.2.1;a) Insbesondere beim öffentlichen Angebot;271
4.3.3.1.1.2.2;b) Versicherungsverträge;273
4.3.3.1.2;3.1.2 Aus institutionenökonomischer Sicht;275
4.3.3.1.2.1;3.1.2.1. Auswirkungen bei (Quasi-)Massenverträgen;276
4.3.3.1.2.2;3.1.2.2 Auswirkungen bei einem einzelnen Vertragsschluss;277
4.3.3.1.3;3.1.3 Psychologische Aspekte;278
4.3.3.2;3.2 Zwischenfazit: Der Kontrahierungszwang zwischen ökonomischem Kalkül und dem Abbau von Vorurteilen;279
4.3.3.3;3.3 Anspruch auf Ersatz des materiellen Schadens;280
4.3.3.3.1;3.3.1 Aus neoklassischer Sicht;280
4.3.3.3.2;3.3.2 Aus institutionenökonomischer Sicht;283
4.3.3.3.3;3.3.3 Psychologische Aspekte;284
4.3.3.3.4;3.3.4 Zwischenfazit: (Un)bewusstes Handeln und rechtliche Verantwortung;285
4.3.3.4;3.4 Anspruch auf Ersatz des immateriellen Schadens;286
4.3.3.4.1;3.4.1 Aus neoklassischer Sicht;286
4.3.3.4.2;3.4.2 Aus institutionenökonomischer Sicht;287
4.3.3.4.3;3.4.3 Psychologische Aspekte;287
4.3.3.5;3.5 Rolle der Rechtfertigungsgründe;288
4.3.3.5.1;3.5.1 Der sachliche Grund;288
4.3.3.5.1.1;3.5.1.1 Aus neoklassischer Sicht;288
4.3.3.5.1.2;3.5.1.2 Aus institutionenökonomischer Sicht;290
4.3.3.5.1.3;3.5.1.3 Psychologische Aspekte;291
4.3.3.5.2;3.5.2 Rechtfertigung bei Versicherungsdiskriminierung;292
4.3.3.5.2.1;3.5.2.1 Aus neoklassischer Sicht;292
4.3.3.5.2.2;3.5.2.2 Aus institutionenökonomischer Sicht;293
4.3.3.5.2.3;3.5.2.3 Psychologische Aspekte;294
4.3.3.5.3;3.5.3 Positive Maßnahmen;294
4.3.3.5.3.1;3.5.3.1 Aus neoklassischer Sicht;294
4.3.3.5.3.2;3.5.3.2 Aus institutionenökonomischer Sicht;295
4.3.3.5.3.3;3.5.3.3 Psychologische Aspekte;295
4.3.3.5.4;3.5.4 Zwischenfazit: Rechtfertigungsgründe als pragmatischer Interessenausgleich;296
4.3.3.5.5;3.6 Beweislasterleichterung;297
4.3.3.5.6;3.6.1 Aus neoklassischer Sicht;297
4.3.3.5.7;3.6.2 Aus institutionenökonomischer Sicht;298
4.3.3.5.8;3.6.3 Psychologische Aspekte;299
4.3.3.5.9;3.6.4 Zwischenfazit: Indifferenz der ökonomischen Analysen und die Fortentwicklung von Beweismitteln;300
4.3.4;4 Die Antidiskriminierungsverbände und die Antidiskriminierungsstellen;301
4.3.4.1;4.1 Die Antidiskriminierungsverbände;301
4.3.4.1.1;4.1.1 Aus neoklassischer Sicht;301
4.3.4.1.2;4.1.2 Aus institutionenökonomischer Sicht;302
4.3.4.1.3;4.1.3 Psychologische Aspekte;302
4.3.4.2;4.2 Die Antidiskriminierungsstellen;303
4.3.5;5 Die Unabdingbarkeit der Regelungen;303
4.3.5.1;5.1 Aus neoklassischer Sicht;304
4.3.5.2;5.2 Aus institutionenökonomischer Sicht;305
4.3.5.3;5.3 Psychologische Aspekte;305
4.3.6;6 Auswirkungen des Gesetzes als Ganzes;306
4.3.6.1;6.1 Soziale Normen, Präferenzänderungen und Pareto-Selfimprovement;306
4.3.6.2;6.2 Debiasing durch Recht;309
4.3.7;7 Zusammenfassung;313
5;4. Teil: Normative Fragen und Antworten;321
5.1;A Folgen aus einer ökonomischen Analyse Handlungsimperative für das Recht?;323
5.1.1;1 Exkurs: Warum stellt sich die Frage der Normativität nicht bei der Interdisziplinarität von Recht und Psychologie?;323
5.1.2;2 Die utilitaristischen Grundlagen ökonomischer Analysen;324
5.1.2.1;2.1 Bentham und J. S. Mill;324
5.1.2.1.1;2.1.1 Grundbegriffe;324
5.1.2.1.2;2.1.2 Kritik;326
5.1.2.2;2.2 Rawls;330
5.1.2.3;2.2.1 Eine Theorie der Gerechtigkeit;330
5.1.2.3.1;2.2.2 Kritik;333
5.1.3;3 Reichtum statt Glück? Normativität und Pragmatismus bei Posner;335
5.1.3.1;3.1 Reichtumsmaximierung als ethisches Prinzip: Grundzüge und Kritik;337
5.1.3.2;3.2 Reichtumsmaximierung und Kaldor-Hicks-Kriterium: Grundzüge und Kritik;340
5.1.3.3;3.3 Reichtumsmaximierung und Pragmatismus: Grundzüge und Kritik;342
5.1.4;4 Methodische Konsequenzen für die Rechtswissenschaft;344
5.1.4.1;4.1 Die ökonomische Analyse des zivilrechtlichen Benachteiligungsverbotes;344
5.1.4.1.1;4.1.1 Recht und Ökonomie;344
5.1.4.1.2;4.1.2 Das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot als Prüfstein der Interdisziplinarität;346
5.1.4.2;4.2 Recht und Psychologie;348
5.2;B Das zivilrechtliche Benachteiligungsverbor – ein Angriff auf die Freiheit oder deren Ermöglichung?;349
5.2.1;1 Formen von Freiheit;350
5.2.1.1;1.1 Grundsätzliches;350
5.2.1.2;1.2 Negative und positive Freiheit;351
5.2.1.2.1;1.2.1 Negative Freiheit und die Abwesenheit von Zwang;351
5.2.1.2.2;1.2.2 Positive Freiheit und selbstbestimmtes Handeln;354
5.2.1.2.3;1.2.3 Freiheitsparadoxe;355
5.2.2;2 Das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot zwischen Freiheitsschaffung und Freiheitsbewahrung;357
5.2.2.1;2.1. Ausgangspunkt;358
5.2.2.2;2.2. Das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot und die negative Freiheit;359
5.2.2.3;2.3. Das zivilrechtliche Benachteiligungsverbot und die positive Freiheit;366
5.2.3;3. Ist Debiasing liberaler Paternalismus oder staatliche Gedankenkontrolle?;367
5.3;C Fazit;374
6;Literaturverzeichnis;377
7;Sachverzeichnis;391