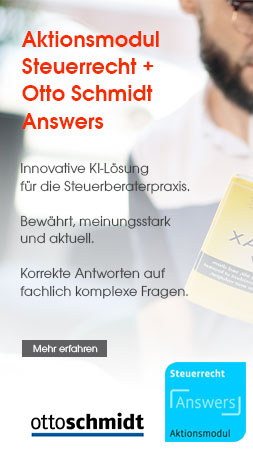Relevanz von Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Regulierung für die geprüfte Finanzberichterstattung
E-Book, Deutsch, 350 Seiten, E-Book
ISBN: 978-3-7910-5533-6
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Die Sammlung an Beiträgen unterstreicht mit ihren verschiedenen Facetten die hohe Anerkennung und Wertschätzung, die Dr. Holger Otte innerhalb des Berufsstands der Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, der Wissenschaft und Wirtschaft sowie innerhalb des internationalen Netzwerks der BDO genießt. Seit fast vier Jahrzehnten – und davon mehr als die Hälfte der Zeit als Vorstand der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – bringt sich der Jubilar aktiv in die Entwicklung der Finanzberichterstattung ein.
Mit der Festschrift ehren wir die Verdienste von Dr. Holger Otte. Gleichzeitig freuen wir uns auch, eine höchst interessante und lohnende Lektüre für alle, die sich für aktuelle Fragestellungen und Entwicklungen in der Finanzberichterstattung und den sich daraus ergebenden Herausforderungen für die Wirtschaftsprüfung interessieren, bereitzustellen.
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
Die Wirtschaftsprüfung im Jahre 2030
Oliver Thomas/Philipp Fukas/ Valerie Siegl/Johannes Langhein1 Die Ablösung regelbasierter Prüfsoftware durch Machine-Learning-gestützte Informationssysteme ist bereits in vollem Gange. Die entstehungszeitpunktnahe Prüfung von Geschäftsvorfällen und prüfungsrelevanten Sachverhalten ist somit aus technischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht mittelfristig nur noch eine Frage der Zeit. Im Laufe dieses Jahrzehnts – so die bewusst visionäre formulierte Behauptung der Autoren – werden klassische Prüfungsansätze sukzessive durch kontinuierliche und unterjährige Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen ersetzt werden, welche die fehlerhafte oder unvollständige Erfassung von prüfungsrelevanten Sachverhalten sprichwörtlich im Keime ersticken. In diesem Beitrag wird anhand exemplarischer Szenarien aufgezeigt, wie ein typischer Prüfprozess im Jahre 2030 aussehen könnte. Gleichzeitig werden kritische Erfolgsfaktoren hergeleitet, die die Realisierung derartiger Szenarien voraussetzen. 1 Ein Blick in die Zukunft der Wirtschaftsprüfung
Der Austausch des Getriebes einer Windenergieanlage der DeltaWind GmbH soll spätestens im ersten Quartal 2030 erfolgen. Diese Erkenntnis lieferten intelligente Auswertungen Mitte 2029 im Rahmen einer Predictive-Maintenance-Analyse von Sensordaten der Windenergieanlage II des Windparks Alpha in Niedersachsen. Andernfalls würde sich die Wahrscheinlichkeit für einen Totalschaden mit jeder weiteren Betriebsstunde erhöhen. Die Betreibergesellschaft DeltaWind GmbH hat unmittelbar auf diese Prognose reagiert und Ersatzteile inklusive der Maschine bereits im Vorjahr bestellt. Für den Austausch des Getriebes wurde die Sustainable Services AG beauftragt, die garantiert, dass die Wartungsarbeiten unter strenger Einhaltung der Herstellerempfehlungen vorgenommen werden. Der Einbau erfolgte unter Begutachtung der Ingenieure des Betreibers am 23. März 2030. Die Rechnung in Höhe von 113.050,00 EUR (inklusive Umsatzsteuer (USt)) wurde am 31. März 2030 von Sustainable Services AG erstellt und der DeltaWind GmbH übermittelt (vgl. Abb. 1). Zum 01.01.2030 wurden seitens der Europäischen Union die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung dahingehend angepasst, dass bei mittelgroßen und großen Unternehmen eine Prüfung von wesentlichen Geschäftsvorfällen vor der Erfassung in den Büchern zu erfolgen hat. Die Prüfungsergebnisse in Form von Transaktionsfreigaben bzw. -ablehnungen sind in einer Blockchain festzuhalten. Die Prüfsubjekte werden zufällig zusammengestellt, es muss allerdings mindestens ein Wirtschaftsprüfer und ein Sachverständiger Teil des Prüfteams sein. Abb. 1: Szenario des Continuous-Auditing-Ansatzes im Jahre 2030 Am 1. April 2030 erscheint auf den mobilen Endgeräten bei Frau Dr. Meyer (Wirtschaftsprüferin), Herrn Dr. Müller (Chefingenieur von DeltaWind GmbH) und Frau Pohlmann (Mehrheitsgesellschafterin der DeltaWind GmbH) die Rechnung der Sustainable Services AG zusammen mit dem Wartungsprotokoll und den Lieferscheinen (vgl. Abb. 2). Mit enthalten in der Nachricht ist ein vorgeschlagener Buchungssatz sowie eine Empfehlung zur Zahlungsfreigabe. Nach 48 Stunden sind seitens Frau Pohlmann und Frau Meyer die Freigaben erfolgt. Herr Dr. Müller hingegen hat auf der Rechnung Positionen entdeckt, die nach seiner Einschätzung nicht erbracht wurden. Er lehnt die Transaktion ab und der Sachverhalt wird damit einer manuellen Nachprüfung übergeben. Nach weiteren 48 Stunden wurde von der Sustainable Services AG eine korrigierte Rechnung übermittelt. Diesmal gibt es seitens des Prüfteams keine Beanstandungen mehr. Die Rechnung ist für die Kreditorenbuchhaltung sowie für die Zahlung freigegeben. Abb. 2: Freigabe der Transaktion durch die Auditoren 2 Wirtschaftsprüfung im Jahr 2030
2.1 Automatisierte Datenpipelines: The New Normal
Schon bald wird dieses Zukunftsszenario der Wirklichkeit entsprechen. Automatisierte Datenpipelines werden die kontinuierliche, unterjährige Prüfung von rechnungslegungsrelevanten Daten aus den unterschiedlichsten Mandantensystemen ermöglichen. Das zukünftige Zusammenspiel der einzelnen Datenpipelines ist in Abbildung 3 skizziert. Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile dieses kontinuierlichen Prüfungsansatzes näher erläutert. Abb. 3: Prüfungsansatz im vernetzten Ökosystem des Unternehmensumfelds 2.2 Die Datenextraktion aus den Vorsystemen
Im Jahr 2030 werden das zentrale Informationssystem des Mandanten sowie weitere Systeme und Tools im Unternehmensumfeld sämtliche prüfungsrelevante Daten beinhalten. Jeder eingetretene Geschäftsvorfall, wie beispielweise ein Wareneinkauf, eine Materialentnahme oder eine Banküberweisung, wird in den digitalen Haupt- und Nebenbüchern erfasst sein (Eisele/Knobloch, 2018, S. 175). Darunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die zwischen dem Unternehmen selbst und Dritten entstanden sind. Dritte können in diesem Zusammenhang beispielsweise Banken, Lieferanten oder Kunden sein. Jeder gebuchte Geschäftsvorfall wird weiterhin auf einem Buchungsbeleg basieren, sodass eine Buchung nur bei der Existenz eines entsprechenden Belegs im Sinne des Handelsrechts ordnungsgemäß ist. Dabei werden sowohl externe Belege wie Geschäftsbriefe, Quittungen, Ein- und Ausgangsrechnungen, Lieferantenverträge oder Kontoauszüge als auch interne Belegen wie Warenentnahmescheine, Abschlussbuchungsbelege oder Gehaltslisten verwendet (Eisele/ Knobloch, 2018, S. 670). Digitale Nebenbücher halten ergänzende Informationen zu den Sachkonten sowie weitere Aufgliederungen vor. Beispielweise sind in den Nebenbüchern für jeden Kreditoren sowie Debitoren Personenkonten angelegt, um die Warenforderungen und -verbindlichkeiten verzeichnen zu können. Anhand der Nebenbücher werden systematisch die Geschäftsvorfälle auf die Hauptbuchkonten verbucht (Eisele/Knobloch, 2018, S. 693). Zur Abstimmung der Buchungssätze gemäß der ordnungsgemäßen Buchführung werden periodisch Summen- und Saldenlisten erstellt (Freidank, 2012, S. 279). Weiterhin werden im Jahr 2030 Controller, Revisoren sowie Wirtschaftsprüfer vorrangig an diesen Prozessen beteiligt sein. Somit entsteht eine zeitnahe, chronologische und fortlaufende Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle. Die Bücher müssen dabei wie heute nach einem systematischen Kontenplan geführt werden (Wöhe/Kußmaul, 2018, S. 41). In der Praxis werden Unternehmen ihren Kontenplan weiterhin aus branchenspezifischen und standardisierten Kontenrahmen ableiten. Dadurch bleiben eine Vielzahl an unternehmensindividuellen Kontierungslogiken bestehen. Heutzutage führen diese unterschiedlichen Kontierungstaxonomien noch zu erheblichen manuellen Aufwänden bei Abschlussprüfern, im Jahr 2030 werden sie durch die automatisierten Datenpipelines und den reibungslosen Einsatz von KI-Modellen kaum noch eine Herausforderung darstellen. Das zentrale Informationssystem des Mandanten wird im Jahr 2030 weiterhin das Enterprise-Resource-Planning-System (ERP-System) sein. ERP-Systeme halten jegliche Geschäftsprozesse, Unternehmensdaten wie Rechnungen, Verträge, Neben- und Hauptbücher digital vor. Dabei existieren eine Vielzahl von ERP-Systemen, bei denen die Datenstruktur und der Funktionsumfang stark variieren können (Langhein et al., 2018, S. 1303). Um die Unternehmensdaten aus den ERP-Systemen der Mandanten zu extrahieren, sind geeignete Schnittstellen notwendig. Gängige Datenformate der Datenextraktion sind hierbei CSV, XML, PDF oder Open Database Connectivity (ODBC) Treiber, eine standardisierte offene Schnittstelle, um auf unterschiedliche Datenbankmanagementsysteme zugreifen zu können (Odenthal/Seeber, 2016, S. 16). Zur Umsetzung einer permanenten Extraktion bedarf es entsprechender Konnektoren, die die verschiedenen technologischen Anwendungen miteinander verknüpfen und somit eine automatisierte Datenextraktion ermöglichen. Heutzutage stellen einige ERP-Systeme bereits Konnektoren zur Verfügung, um das Auslesen von Informationen zu automatisieren (Gronau, 2021, S. 42). Im Jahr 2030 werden sich webbasierte Konnektoren flächendeckend durchgesetzt haben und somit den automatisierten kontinuierlichen Prüfungsansatz ermöglichen. 2.3 Intelligente Preprocessing-Pipelines
Die Datenvorverarbeitung stellt die Schnittstelle zwischen den Informationssystemen der Mandanten und denen der Prüfungs- und Beratungsgesellschaften dar. Heutzutage sind zur Verbindung dieser Systeme sehr aufwendige Datenaufbereitungen notwendig (Klauser/Herzog, 2019, S....